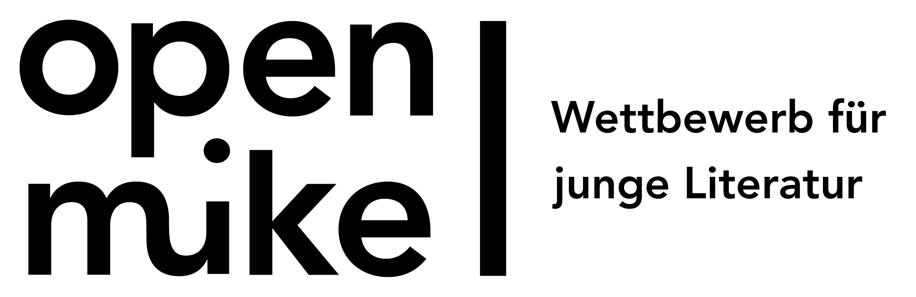Eva Raisig zeichnet in »Ein Arm geht verloren, noch einer« ein lakonisches Familiendrama aus der Perspektive der jüngeren zweier Schwestern.
Die Wunde suppt und riecht übel. Zwischen den Dämpfen der Vater. Er brüllt nun schon eine Weile nicht mehr.
Die Wunde. Sie dient dem Text als übergreifendes Motiv für Schuld. Die Beschreibungen des Eiters, des Gestanks, des Ekels haben fast schon sinnliche Qualität. Ob Kafkas »Der Landarzt« einen Teil zu dieser Bildsprache beigetragen hat?
Langsam, in vielen verwobenen Zeitebenen wird die tragische Geschichte einer zunächst vierköpfigen Familie aufgebaut. Der Vater hat sich die Überreste seines Armes abgeschossen, um sich von seinem SS-Blutgruppen-Tattoo zu befreien. Er wird an der entzündeten Wunde sterben.
Die Zeitebenen verschwimmen. Eine Kindheitserinnerung an ein treibendes Stück Holz beim Spaziergang mit dem Vater bereitet auf den nächsten Schicksalsschlag vor: Die ältere Tochter stürzt sich in den Main. Gefunden wird nur ein Arm mit einem Ring am Finger zur Identifizierung. Die Szene, in der anhand einer Fotografie die Unabänderlichkeit des Todes verhandelt wird, ist verhältnismäßig lang, der Schmerz der Familie umso tiefer.
Der abgetrennte Arm als Metapher für Schuld, die sich nicht abtrennen lässt. Trotz der teilweise sehr vielen Zeitebenen schafft es Eva Raisig, dem Thema des vererbten Traumas ein sehr bildstarkes und dichtes Narrativ zu geben. Auch wenn dem Bild des abgeschossenen Armes eine solche Dramatik innewohnt, dass die erzählerische Logik fast zu kippen droht. Bemerkenswert, wie der vielschichtige und düstere Text in kurzer Zeit das Schweigen eines Traumas mit einer Intensität lebendig macht, die lange in der Halle des Heimathafens nachklingt.