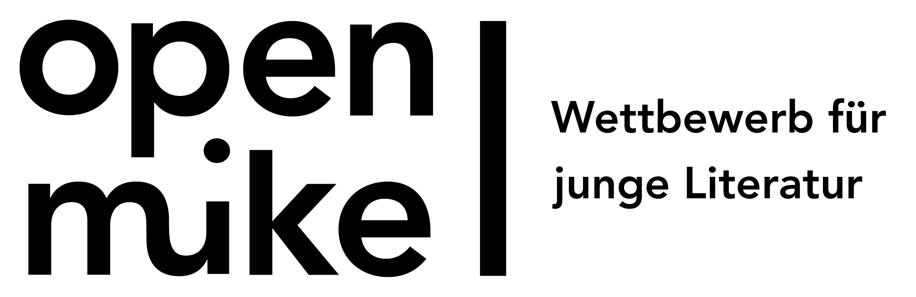Wie schon in den vergangenen Jahren, gab es im Vorfeld des open mike einen Workshop für die Teilnehmer des Vorjahres. Diesmal stand er unter dem Motto »Literarische Traditionen«. Kathrin Röggla hielt die Keynote, die wir hier ungekürzt veröffentlichen.
Es gibt heute gute Gründe für Zeitreisen. Zumindest punktuell. Denn wir waren schon mal woanders, so politisch gesehen, so gesellschaftlich, wir waren weiter, zumindest punktuell! Man könnte dies als Grundgefühl unserer Zeit bezeichnen, das von der Seite betrachtet auch immer wieder als kulturpessimistisch, rückwärtsgewandt diffamiert wird, dieser Hang zu den Trips in vergangene Zeiten hinein, die bekanntlich immer besser waren. Aber zugegeben, ich bin auch gegen Zeitreisen, strikt, dieser ganze Eventtourismus stinkt zum Himmel! Ich bin allerdings dafür, die Kommunikation aufzunehmen, vielleicht mal sein Ohr an die Gefäße zu halten, die uns zur Verfügung stehen: Kassiber, Schiffsbäuche, kommunizierende Röhren als die uns literarische Texte entgegenkommen können. Was höre ich da? Vielleicht höre ich Hubert Fichtes Fensterputzerkarl aus der »Palette« sprechen »Wo soll man anfangen, sagt der Fensterputzerkarl da – es ist so viel. Alle die Gebiete, und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das eine ist nicht zu verstehen ohne das andere. Entweder muß ich dumm bleiben oder ich werde verrückt, wenn ich alles gründlich studiere. Ich bin zu alt. Ich kann doch nicht mehr alles lesen. Vielleicht können mir die, die schon auf Vorrat gelesen haben, ein bißchen helfen. Deshalb habe ich mein Notizbuch immer dabei.« (pal, s.42) Soweit der Fensterputzerkarl in Hubert Fichtes Palette. Halten wir noch immer Ausschau nach denen, die auf Vorrat gelesen haben? Haben wir gar selbst auf Vorrat gelesen? Nein, das ist doch nicht möglich. Wenn es gute Gründe für Zeitreisen gibt, so gibt es mindestens doppelt so viele Gründe, diese Kommunikation mit literarischen Äußerungen anderer Zeiten aufrechtzuerhalten, und ich spreche hier ganz absichtlich von Kommunikation, denn die Texte, die wir lesen, sind nur scheinhaft Objekte oder gar Bildungsgut, sie werden von uns erst zum Leben erweckt, von unserer Antwort, umso mehr, fällt sie literarisch aus, sie sind wesenhaft ausgerichtet auf diese Antwort. Einer der Gründe, diese Kommunikation ernster zu nehmen, wäre der der Allianz, heimlich oder nicht, ein anderer der der Rettung. So war das bei mir mit Elfriede Jelinek, mit Hubert Fichte, mit Alexander Kluge, mit Werner Schwab, aber nicht mit ihnen alleine, sondern mit dem, an was sie sich anschließen. Ein Autor ist noch keine literarische Tradition, aber er kommt woher, er bezieht sich auf was. Der offensichtlichste Grund, die Kommunikation aufzunehmen, scheint zunächst also der zu sein, dass wir uns sowieso stets in der vertikalen Zeitebene befinden. Unser Schreiben und Denken knüpft ständig an Traditionen an, auch wenn wir meinen, wir tun es nicht, wir setzen uns gar ab, wir lassen hinter uns. Literarische Gesten entwickeln sich, werden vorbereitet, auch wenn sie sich selbst im Dadagestus einen Ursprungsstatus verpassen, wie das Greil Marcus für Punk in Lipsticktraces gezeigt hat: Selbst die übelste Punk-Aktion hatte ihre Verbindung zu Dada, und wenn nicht intentional, dann spätestens bei der Wahrnehmung von außen, die Leserschaft liest eben mit. Denn so funktioniert das Ganze nunmal. Der Grund, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, weil sie ohnehin gesprochen wird und man sich besser aktiver darin verhält, kommt natürlich erst einmal sehr defensiv daher. Und doch, verbindet sich damit auch die Einsicht, dass es um etwas geht, sieht es anders aus. Wir leben schließlich nicht im luftleeren, sondern in einem hegemonialen Raum. Kultur ist ein Streitraum. Es wird auch über und durch künstlerische Gesten gestritten, debattiert, Machtpositionen gefestigt, Wahrheiten befragt etc. Die Formen, in denen wir das tun, die ästhetischen Formen sind eingespannt in jene untergründige Kommunikation der literarischen Traditionen, die so vielfältig sind und sich so unterschiedlich miteinander verweben können. Ein Schreiben, das Hegemonie ästhetisch reflektiert, wird damit zu tun haben. Denn das Absurde ist, dass entgegen jeder öffentlichen Behauptung gerade das Abseitige, Minoritäre, Kleine umso mehr in diesem vertikalen, diachronen Raum verhaftet ist, es benötigt ihn, um Allianzen zu suchen, Kommunikationssysteme zu bauen, soviel habe zumindest ich erkannt. Dabei geht es weniger um Legitimationsgesten, als um eine Komplizenschaft, eine Art der Teamwork, die eben nur so möglich ist. Mainstream scheint keine Traditionen zu brauchen, der sitzt mehr auf ihnen. Während ich dies schreibe, denke ich an ein Statement von Diedrich Diedrichsen, dass das in jedem Jazzfestival praktiziert werde, nur im Theater und in der Literatur dürfe es nicht sein, weil es nach Bevormundung und Anstrengung rieche, Traditionslinien zu erstellen. Meine Linien, ausgehend von Hubert Fichte, Alexander Kluge, Elfriede Jelinek, Denis Johnson führen über Arno Schmidt, Eugene Ionesco, Dada bis hin zu Jean Paul und Lawrence Sterne, hin zu Rabelais und Fischart. Diese Linien liegen nicht fest, sie verschieben sich mit meinem eigenen Blick, und es ist eine zutiefst politisch-ästhetische Arbeit, welche Konstruktion von Traditionslinien man jeweils unternimmt. Manchmal ist es auch nicht ganz nachvollziehbar. Gerade jemand wie Hubert Fichte hat sich beispielsweise extrem an die literarische Tradition des Barock gehalten, aber trotzdem kann er mir als Fichte-Fan seine Begeisterung für Daniel Caspar von Lohenstein nicht ganz näher bringen. Arno Schmidts berüchtigte Fouqué-Besessenheit hat ihm zwar in seinem Werk weitergeholfen, findet seinen Weg aus ihm aber nicht mehr ganz so gut heraus. Hubert Fichte ist mir in dieser Arbeit im Vertikalen allerdings besonders lieb als Spezialist für Riten, gesellschaftliche Formen und Traditionen jenseits eines Ursprungsdenkens, im Sinne der Erforschung des Hybriden, deswegen soll er hier noch einmal zu Wort kommen. Ich sehe Detlev, Hubert Fichtes alter ego aus »Detlevs Imitationen Grünspan« als kleiner 11- oder 12-jähriger Junge vor dem Bücherschrank seiner Mutter stehen. »Im Bücherschrank liegt die „Marquise von O« als Feldpostausgabe. Mutti ist arbeiten. Sie hat den Schrank abgeschlossen, weil Detlev die Marquise von O. nicht lesen soll. Der Schlüssel vom Schuhschrank passt auf den Bücherschrank, und es fängt an nach Mutter zu riechen. Schminke. Ein Würfel aus Bienenwachs. Schiller. Franzbranntwein. Hinter Schiller versteckt Dr. Rudolf Steiner »Die Geheimwissenschaft«. Hinter Dr. Rudolf Steiner versteckt: Heinrich Heine »Der Rabbi von Bacherach« (Detlev, s. 70) – Diese Schichtungen von Geheimwissen, die Verschachtelung der Werke ineinander, sind eine frühe und, man könnte sagen äußerst zeittypische Erfahrung Hubert Fichtes. Gleichzeitig zeigt er wie die entstehenden Beziehungen zu literarische Traditionen trotz aller Rettung nichts mit einem langfristigen Gewinn an Sicherheit und einem Festhalten zu tun haben, es geht hier nicht alleine um Bereicherung wie der Bildungsgedanke dies suggeriert. Genauso wie Reisen einen dekomponieren können, kann die Konfrontation mit literarischen Traditionen auch gefährden, weil sie einen in Frage stellen, mal radikaler mal weniger. Heute, wo wir merkwürdigerweise nicht mehr von einem Geheimwissen ausgehen, zumindest, was die Literatur betrifft, und wir vermutlich selten glauben, Bücher hinter Büchern, in Büchern verstecken zu müssen, um uns das verborgene Wissen, die enigmatischen, hermetischen Wissenszusammenhänge, in die nur Eingeweihte dürfen, anzueigenen, muss erneut klar gemacht werden, dass alles Wissen der Welt eben nicht vor unseren Augen liegt. Wir leben nicht in einer Informationsgesellschaft, sondern in einer Desinformationsgesellschaft, worauf man Zugriff hat verhindert nicht selten den Zugriff auf anderes und das hat, wie der Politologe Colin Crouch über die Zerstörung des Wissens im Neoliberalismus gezeigt hat, System. Doch Wissen ist niemals nur Information, es ist auch Form, Konstellation, Ästhetik. Es gibt ein künstlerisches Wissen, das aus einem Gewebe an Gesten, Rhythmen, Montagen, Formaten, Stil, orthographischen, akustischen und bildlichen Operationen besteht. Dieses Wissen weiter zu treiben, kann auch als eine Widerstandsarbeit gesehen werden. Die Vorstellung, dass es keiner ästhetischen Geheimsprachen bedarf, dass alles so öffentlich wie möglich und so leicht lesbar wie möglich gemacht werden muss – seine Eingängigkeit stets bei sich tragen soll, also auf Traditionen sitzt, die nicht mehr als solche bezeichnet werden können, weil sie scheinbar zeitlos sind, mag sich durchgesetzt haben. Allerdings kann dies nur eine Gesellschaft äußern, die von sich behauptet, soziale Verwerfungen nicht mehr vorzufinden und in einer demokratischen Transparenz zu leben, etwas, von dem wir uns gerade in Lichtgeschwindigkeit verabschieden. Zum anderen übersehen wir die versteckten Voraussetzungen dieser Eingängigkeit. Auch sie bedarf der Formen und Formate, die allerdings ihr Programm nicht so sehr bekannt geben und insofern Komplizen einer Zementierung von Machträumen sind.
Ein weiterer Irrtum ist es, zu glauben, wir müssten uns nicht mehr von Traditionen lossagen, weil das nicht nur längst geschehen ist, sondern eben auch der Kern der neoliberalen Revolution darstellt. Etwas zu verwerfen, wäre einfach inhaltlich erledigt. Nichts ist erledigt. Sicherlich kann man diese Brüche nicht mehr geradlinig nach vorne inszenieren, es ist dafür die Sichtbarmachung des zu Verwerfenden überhaupt erst nötig, weil es sich wie gesagt in Zeitlosigkeit versteckt (und damit nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart preisgibt).
Das bringt uns zum Hier und Jetzt. Dem, was heute hier rund um den Heimathafen Neukölln stattfinden kann. Es ist ja eine Art World Cafe (auch so eine neue wissensästhetische Tradition), eine schwarmintelligentes Brainstorming ästhetiktheoretischer Entwürfe, Argumente. Und sie werden sehr divers sein, das ist das Ziel. Unterschiedlich sind auch die Themen, zu denen wir uns zusammensetzen. Aber ich frage mich, ob wie sich die Form der vermeintlichen Zeitlosigkeit gewisser Gesten an unserer Gegenwärtigkeit reibt. Warum machen wir heute das, was wir machen? Hätten wir das vor zehn Jahren auch schon gemacht? Von welchem Punkt aus handeln wir, wenn wir uns selbstdarstellen, wenn wir stimmlich performen, wenn wir von politischem Auftrag sprechen, wenn wir der Kunst als Lebensform, der Avantgarde zuwenden?
Kathrin Röggla (*1971, Salzburg) lebt als freie Schriftstellerin in Berlin. Sie veröffentlicht Prosa, zuletzt »die alarmbereiten« (S.Fischer, 2010), Essays, zuletzt »Die falsche Frage. Über Theater, Politik und die Kunst, das Fürchten nicht zu verlernen« (Theater der Zeit Verlag, 2015), sowie Hörspiele und Theatertexte. Für ihre literarischen Arbeiten wurde sie mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Arthur-Schnitzler-Preis (2012).
Sie ist Vizepräsidentin der Akademie der Künste in Berlin.