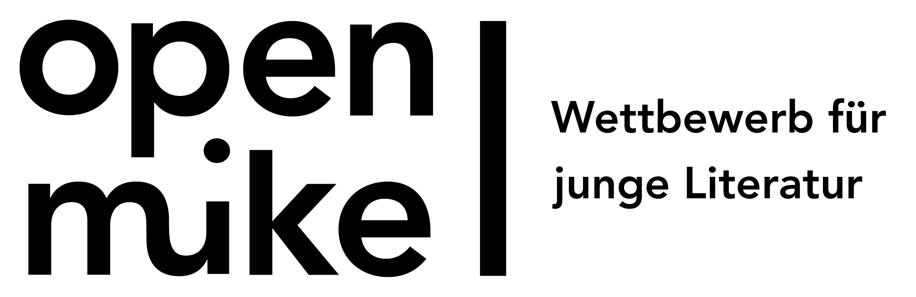Nachdem schon der Titel „Liebe in Zeiten der Schreibschule“ die ersten Lacher aus dem Publikum erntet, hält auch der Text, was er verspricht: Jede Menge Sex, Drugs and Rock’n’Roll zwischen vergeistigten Hipstern an einschlägigen Schreibinstituten, mit einer Überdosis intertextueller Verweise, Nobelpreisträger in der ersten Reihe. Dazu: eine klassische Dreiecksgeschichte, aus der der Ich-Erzähler als Verlierer herausgeht, konsequent, denn „wenn du jemanden fertig machen willst, muss die Geschichte aus der Sicht deines Opfers erzählt werden.“ Eine selbstironische Abhandlung hören wir da, über eine Welt, in der sich der verkannte Künstlernachwuchs noch beim Geschlechtsverkehr an der Bedeutung des Bindestrichs aufgeilt, Gleichsetzung von Sprache und Sex. Und wenn es dann zur Sache geht, hört sich das so an:
„Mund trocken, Augen trocken, Mund schließen, Augen schließen. Xerxes, Bote, Chor, Dareios, Atossa, die geile Schlampe – Oh, oh, weh mir.“
Die Klischees der eigenen Spezies, die spätestens nach Florian Kessler kein Geheimnis mehr sind (Lektorin Diana Stübs nennt den Text eine Entgegnung auf die von Kessler angestoßene Debatte), hat auch Wolf gut erkannt und noch einmal literarisch aufgearbeitet, schönes Modell: die „Maxim-Biller-Brille“ der „Schlampe“. Diese wie gesagt entscheidet sich für David, den biografisch legitimierten auf die Antisemitismustränendrüsedrücker. Doof. Da bleibt der namenlose Ich-Erzähler doch nur ein Bindestrich, denn »Bindestriche bleiben die einsamsten Zeichen der Welt, nur dafür da, dass zwei andere sich treffen.« Süß. Zum Lachen. Aber leider ausgelutscht.
***
Leseprobe: Michael Wolf; Liebe in Zeiten der Schreibschule
Die Geschichte wird nicht von den Siegern geschrieben, sondern wer die Geschichte schreibt, hat gewonnen, hat die Vergangenheit in seiner Weise gestaltet. Darin stimmen wir als Letztes überein, ihre Abwesenheit bei Facebook, meine auf dem Campus sprechen dafür. Wir gehen an die Front des Schreibtisches, hämmern auf unsere Flachtastaturen ein, die Kampfzone ist Umschalttaste AUSGEWEITET, Tütensuppe und Gebäckkrümel fallen ins Niemandsland, den Verdun-Vergleich erspare ich, mir, dem Erzähler der Wahrheit, dem Wahrsager der Geschichte von Judith, der dummen Fotze Ausrufezeichen.
»Warum schreibst du die Ausrufezeichen aus?«, fragte sie in den Seminarraum.
Um uns Jungliteraten, über Macbooks gebeugt, glitzerten Laschen von Fusion-Bändchen im Licht der einfallenden Sonne.
Verheißungsvoll landeten die Reflexionen auf dem Zigarettenetui der Seminarleitung, ließen Bachmann, Büchner, Buxtehuder Bulle in die Zwischenräume weißen Pulvers einfallen. Hier war alles möglich, konnte alles geschrieben werden. Nur »Das mit den Ausrufezeichen ist ein Dilemma«, blieb einzig ich nüchtern, textimmanent: »Die sehen einfach scheiße aus, die sind für das Schriftbild absolut tödlich. Dieser herrische Strich und dann noch der Punkt da drunter.«
Unwillig schüttelte ich den Kopf, Judiths Augen funkelten im Takt.
»Außerdem transportieren Ausrufezeichen so eine Hysterie, als wolle da ein Satz unglaublich rausstechen, aber das soll er ja gar nicht. Im Gegenteil, das Ausrufezeichen ist nötig, damit ein Text weitergehen kann, obwohl er eigentlich aufhören müsste. Also, ein Fluch zum Beispiel reißt alles Folgende mit sich, wenn er nicht von einem Ausrufezeichen aufgehalten wird. So ein Aufhaltezeichen sorgt dafür, dass der Text nach einer kurzen Pause immer und immer weitergehen kann. Da ist dieser hässliche Strich dann so was wie eine Schranke, eine Wegmarke im Text. Aber eben, wenn ich es ausschreibe, nur inhaltlich, aber nicht im Text als Bild.«