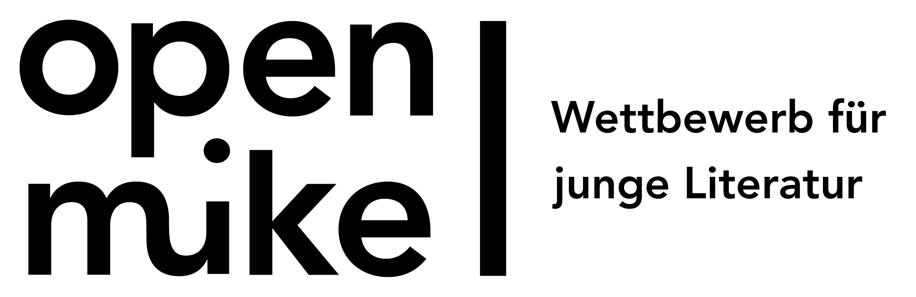Das Setting: Ein schlossähniches Haus, das auf sonderbare Art auch ein öffentlicher Ort zu sein scheint, das Esszimmer wie ein gläserner Schneewittchensarg („Seht nur, sie isst mit Stäbchen, aus Elfenbein geschnitzt, in Gold getaucht und mit Diamanten besetzt. Ihre Prinzessin, sie lebe hoch, hoch, hoch!“).
Die Prinzessin: eine mutterlose Tochter, die bei ihrem verrohten Patriarchenvater aufwächst.
Der Vater und sein Sozius, der Rauhaardackeldeckrüde: „In Trainingshose und Pantoffeln. Beides ganz verkrustet vom allabendlichen Programm seines Hundes, der allerdings, bevor er rammeln durfte, noch die Tochter zu beißen hatte, denn auch der Vater wollte sich vergnügen.“
Riedel hat ein modernes Missbrauchsmärchen vorgelegt, dass sie beim Lesen so seziert, wie die Vaterfigur das Fleisch auf seinem Teller, „am liebsten waren ihm jedoch Hühnerärsche“. Es geht uns etwas an, was dort passiert, in diesem halb-skurrilen, halb-realen, halb-verschlossenen und halb-ausgestellten Raum. Die Rache der Prinzessin, der Vatermord auf der Kellertreppe, war jedoch keine Überraschung. Deswegen ist der Text zwar phantastisch angelegt, im doppelten Wortsinne, lässt einen jedoch unbefriedigt zurück.
***
Leseprobe: Alexandra Riedel; Die Prinzessin
Deine Tochter hat wieder einmal irgendetwas gemacht oder wieder einmal irgendetwas nicht gemacht, sagte der Vater, wenn er fand, ihre Tochter habe oder habe eben nicht – und zwar zum wiederholten Male.
Nichts von dem, was sie tat oder unterließ, entsprach seiner Vorstellung von einer Tochter, die diese Tochter, da sie nicht seine war, ohnehin nie hätte erfüllen können. Insofern kam es weder auf das Was oder Was-Nicht noch auf die Wiederholung des Gemachten oder nicht Gemachten an. Es war ihre bloße Anwesenheit, die der Vater zunächst nur der Mutter, später auch ihr zur Last legte.
Die Mutter hatte sich nicht zur Wehr gesetzt, lächelnd ihr kleines Bündel getragen, es irgendwann ganz sanft vom Rücken genommen und vor sich her geschoben, stoisch auf den Moment wartend, da es neben ihr laufen könnte. Ja, eines Tages, da würden sie und ihre Tochter ein prachtvolles Zweiergespann abgeben, würden den Karren gemeinsam aus dem Dreck ziehen.
Zaumzeug und Deichsel lagen schon bereit. Aber das Leder wurde so morsch, das Holz so marode, die Mutter so matt, dass es plötzlich allein an der Tochter war, sich zu kümmern, und sie kümmerte sich, indem sie ihn, den Vater, die Stufen zum Weinkeller, den niemand außer er selbst betreten durfte, hinunterstieß – eine Gelegenheit, die sich ihr zufällig und im Vorbeigehen bot, obwohl sie doch seit einer Weile eher mit dem Gedanken gespielt hatte, ihn zu erstechen, mit seinem Messer, dem Spezialmesser aus der oberen Küchenschublade, immer geschärft, von ihm, der damit jeden Sonntagmorgen um sieben Uhr Tierleiber ausweidete und zerhackte, damit sie auch ja alle in den Schmortopf passten.
Er, der Vater, war der große Koch. Er kochte, kochte immer, aber Backen, das war nichts für ihn, das war etwas für Weiber. Er bestand sogar darauf, dass sein Kuchen gekocht sei, nicht gebacken. Niemand hätte ihm vorwerfen können, ihrer Tochter habe es an guten Speisen gefehlt, nein, nein.