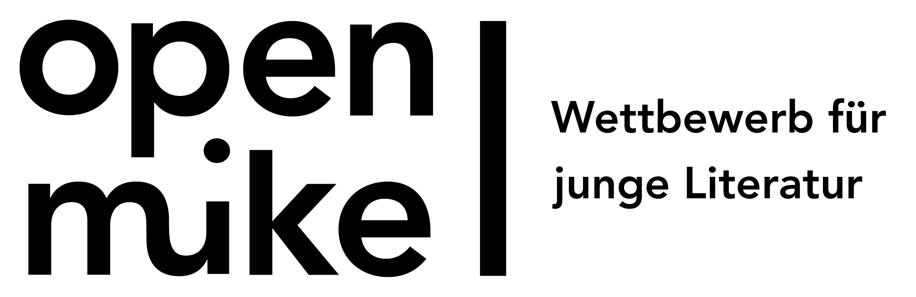Eine kleine Premiere: Zum ersten Mal ist in diesem Jahr die Keynote zum open mike Teil der Auftaktveranstaltung. Hier kommt die Rede von Kathrin Röggla an die Kandidat:innen.
So wird ein Schuh draus – ein Schuh? wirklich? – ja, Gehen, das wäre es!
Mir fällt zu Hitler nichts ein
Karl Kraus
Ja, liebes Publikum: Ich sagen und los geht’s, das ist die Position, auf der ich gerade stehe. Aber ich kann mich auch ein paar Zentimeter auf die Seite stellen und das mal betrachten. open mike. Tell your story. Schön wärs.
Denn: Wer bestimmt eigentlich, was ich schreibe? Das Wörtchen ich wäre verlockend, aber jeder hier weiß, dass das nicht stimmt. Denn natürlich bin ich, sind schreibende Menschen getrieben. Von unserer Zeit, von Moden. Vielleicht sogar von dem, was man Betrieb nennen mag, natürlich nicht so direkt, aber zumindest die Wahrnehmung literarischer Texte läuft in diesem Rahmen ab. Und doch: Jede Rede, die ich hier halte, sollte eigentlich von dem erzählen, wie ich trotzdem mein Ding mache, d.h. meine Ästhetik entwickeln kann, denn – open mike – das ist ja sozusagen der Selbstermächtigungsmoment schlechthin, trotz allem. Das ist in unseren Zeiten nicht genug wertzuschätzen. Wir erleben derzeit ein fundamentales Erstarken rechtsextremer Strömungen, die Normalisierung und Gewöhnung an den Begriff »Rechtspopulismus« spricht Bände, mittlerweile stört es dieses Klientel auch nicht mehr, rechtsextrem genannt zu werden. Die letzten Wahlen deuten darauf hin, dass die AFD immer mehr Wähler*innen anziehen kann und es ist erwiesen, dass das nicht reine Protestwähler*innen sind. Diese politische Beruhigung, eine vermeintliche Beruhigung können wir uns nicht mehr leisten. Es ist zu erwarten, dass im Falle einer Regierungsbeteiligung uns z.B. eine völlig andere Kulturpolitik blüht, und wir sollten Kräfte sammeln und überlegen, was wir dagegen tun können. Zusammen, aber auch in unserer Arbeit. Vielleicht hat gerade Literatur Möglichkeiten in der Hand, auf ihre Weise etwas zu unternehmen? „Mir fällt zu Hitler nichts ein“, jenes berühmt gewordene Zitat des österreichischen Schriftstellers und Satirikers Karl Kraus anlässlich Hitlers Machtübernahme, nach seiner über 30 Jahre regen Publikationstätigkeit gegen rechten Hass, mahnt mich, dass es zu einem Punkt kommen kann, an dem die reine Literatur arm aussieht, auch wenn sie es niemals ist.
Machte ich jetzt nochmal einen Schritt zur Seite, könnte ich gleich jemanden beobachten, der fordert, man möge als Autor/Autorin eine Position beziehen, eine klare Haltung zeigen. Doch in der Literatur ist Position zu beziehen keine einsprachige Sache. Es bedeutet in eine Verstrickung zu geraten. Der Gedanke, dass man die dafür notwendigen Verfahren mit der Bezeichnung »eine Haltung einnehmen« zusammenfassen könnte, ist nur oberflächlich hilfreich. Was ist überhaupt Haltung? Etwas Militärisches? Etwas Bewegliches? Wenn man sich den Begriff der Haltung genauer ansieht, verschwimmt er vor den Augen. Und vielleicht gehört er zu den Begriffen, die ich besser nicht genauer ansehe, weil sie gerade so brauchbar sind, und ich sie bei näherer Betrachtung ganz verlieren könnte. Das Brauchbare hat in meinem Arbeiten übernommen, und es ist einerseits ein schlechtes Signal, andererseits immer noch besser als das Absolute. Ich frage mich also, was hätte ich dann anderes zur Hand? Agitprop? Außerdem möchte jeder und jede im Augenblick die richtige Haltung haben. Es stellt sich aber die Frage, ob das überhaupt das ist, warum wir Texte lesen? Wollen wir uns anhalten an etwas? Feste Positionen kennenlernen? Orientierung erhalten? Noch vor ein paar Jahren wären das rein rhetorische Fragen gewesen, heute bin ich mit nicht mehr sicher.
Wann habe ich zuletzt den Begriff »mein Stoff« oder »der Stoff meines Romans« gehört? Der Stoffbegriff ist ganz vom Sprechen über »Themen« verdrängt, und es ist klar, dass im Literaturmarkt die Dinge funktionieren, die an Themen angebunden sind, (Klima, Nazis, der Osten, Flucht, Krankheit) sich mit einer besonderen Autor*innenidentität – trans, ostdeutsch und weiblich, migrantisch, verbinden. Das ist nicht moralisch verwerflich, im Gegenteil, es ist nur literaturfern. Aber Literatur selbst hat eine literaturferne Note bekommen. Seit wann ist das so? Immer schon, könnte man mir entgegenhalten, es hat sich nur in dem Moment, als die Welt selbst mit literarischeren Begriffen beschrieben wurde, verstärkt, als bräuchte es da einen Ausgleich. Wir sprechen seit vielen Jahren über das Bedienen von Narrativen, freiwillig und unfreiwillig, als gebe es im Diskurs quasi naturhaft eine Landschaft aus Mikro-Erzählungen, die wirkmächtig sind, und die man einmal anwirft, einmal unterläuft und einmal durchkreuzt. Es ist ein Begriff, der eine formale Behauptung in sich trägt, obwohl Narrative wie Legenden sich jeglicher Form anpassen. Eine Art mündlicher Erzählkosmos, der sich den jeweiligen Formaten fügt. In die Debatte ist also eine Menge Verwirrung über Form gekommen.
Nur so kann ich es mir erklären, dass mir im vergangenen Jahr gleichzeitig der Vorwurf des Formalismus, der Ästhetisierung wie des AgitProp gemacht wurde, eine Verwirrung der Kriterien, ein publizistisches Nachdenken über Themen, nicht über Stoffe, die bereits Geschriebenes beinhalten, eben Material, und eine Erwartungshaltung an die Literatur, das zu machen, was einem die vermeintlich angemessene politische Position bietet – aus der Vogelperspektive heraus.
Welche Versprechen geben wir überhaupt, wenn wir einen literarischen Text schreiben? Eine pädagogische Aufbereitung eines Stoffes? Eine sinnliche Evidenz, wie sich das Grauen anfühlt, die Beschädigung sichtbar zu machen? Oder Handlungsmodelle zu entwickeln, Utopie bereitzuhalten, über gesellschaftliche Verhältnisse zu informieren, sie zur Kenntlichkeit zu entstellen? Distanz und Nähe gleichzeitig zu schaffen, Intensität zu erzeugen und genau zu sein, sowie Protest bereitzuhalten, Begehren freizulegen, etwas zu erzählen, was Wissenschaft und Journalismus nicht so fassen können, Abkürzungen schaffen, denn uns bleibt so wenig Zeit.
Es sind jedenfalls jede Menge durchaus berechtigte Erwartungshaltungen, denen wir begegnen, aber sie können sich immer auch gegen den Text richten, als eine Art Manko.
Literatur ist ein Versprechen, aber eines, welches nicht mehr so oft gehört werden möchte wie noch vor ein paar Jahren. So nehme ich aus der eben zu Ende gegangenen Buchmesse mit, wo über fehlende Buchverkäufe in die Breite die Rede war. Das hat viele Gründe, aber eines muss sein, dass das Versprechen relativ gesehen nicht mehr groß genug für viele ist. Dabei ist Literatur auch von produzierender Seite ein Ort der vielen und nicht nur ein Ort einzelner, die es sozusagen wettbewerbstechnisch schaffen, und auch dafür steht der Open Mike. Und das hat mich hier viele Male begeistert.
Wenn ich sage, dass Literatur ein Versprechen ist, dann sicherlich nicht ein einzelnes. Es geht immer in verschiedene Richtungen gleichzeitig. Das zutiefst humane Begehren allerdings, die Opfer zu Wort kommen zu lassen, steht im Moment im Vordergrund, vermutlich als eine Art Ausgleich und Abbitte an das, was im wirklichen Leben aus unterschiedlichen Gründen nicht stattfindet. Aber wie können wir das tun? Wie können sie im Text sprechen, wenn sie da draußen an maßgeblichen Orten nicht zu Wort kommen, ja, wenn ihnen oftmals ihr Opferstatus abgesprochen wird, der gleichzeitig auf der symbolischen Ebene (niemals real) eine begehrte Position ist. Wie deutlich können sie sein, ist es wirklich eine klare Sprache, scharf und prägnant, die uns hier begegnet, eine affektbesetzte oder gerade nicht? Und wer darf ihnen zuhören? Können wir uns identifizieren, wollen wir in ihre Erfahrung als Opfer wirklich hinein und diese merkwürdige Identität bestätigen? Deswegen ist im Menschenrechtsdiskurs stets von den Überlebenden die Rede. Als Wertschätzung des wehrhaften Überstehens. Die Widerstandskräfte gegen die Tat und die Täter*innen zeigend. Es ist auch eine literarische Strategie, die allerdings nicht immer geboten ist, z.B. wenn sie das Problem der Verantwortung zu schnell verlässt, die Sprache der Tat, die oftmals erschreckend stark mit der unsrigen verbunden ist. Und manchmal muss das Schweigen überhandnehmen, wenn ihm zuviel anderes Schweigen gegenübersteht. Viel ist dazu geschrieben worden, von Primo Levi bis Herta Müller, von Judith Butler bis Marguerite Duras – in Zeiten von Täter-Opfer-Umkehrbewegungen und strategischer Diskursbesetzung ist dieses Thema noch komplexer geworden. Und wir erleben gerade heute eine merkwürdige Unsichtbarkeit inmitten einer medialen Explizitheit des Terrors, wie er in Israel stattgefunden hat. Die Sichtbarkeit dieses unglaublich grausamen Überfalls und der Ermordung von mehr als 1400 Menschen verliert sich allzu rasch, auch die Solidaritätsbekundungen scheinen nicht laut genug zu sein, denn sie wurden gleich wieder überlagert von einer etwas dröhnenden Aussage über das dröhnende Schweigen des Literaturbetriebs, das als Nachricht durch Presse und social media ging. Es sind solche rhetorischen Gesten, die mich ratlos werden lassen. Warum muss ich auf Kosten vieler, die sich mit Statements und Veranstaltungen zu Wort gemeldet haben, mich solidarisch zeigen? Zementiere ich nur deren Nichtgehörtwerden? Was wäre die Lautstärke, die gewünscht wird? Aber selbst dieser Gedanke sollte sich mittlerweile der Frage unterordnen, wie ich dem massiven Antisemitismus, der sich in unserer Gesellschaft hier in Deutschland zeigt, begegnen kann?
Unendlich groß ist der symbolische Raum, wie klein unsere Handlungsmacht! Nein. Unendlich groß der symbolische Raum, in dem Handlungsmacht angerufen wird, die dann sehr klein antwortet. Rituell hier seine Stimme zu erheben, macht man doch nicht nur, um über die erlebte Ohnmacht hinüberzuhelfen.
»We are united in grief« übertitelte das Zürcher Neumarkttheater sein Statement nach dem Terrorangriff der Hamas und ließ mich zurück mit der Frage, ob wir hier nicht an ein psychologisches Unvermögen stoßen. Funktioniert globale Trauer? Wo beginnt Trauer, ist sie dasselbe wie Erschütterung? (Kann ich abstrakt trauern?) Und sind wir darin wirklich verbunden oder müssen wir um diese Verbindung ringen? Vielleicht benötigen wir dazu auch die Stimmen, die uns die Literatur schenkt?
Die Vorstellung allerdings, dass sich Literatur in Stimmen äußert, die nun endlich zu Wort kommen, erweckt in mir allerdings die Vorstellung von Texten als Plattformen, auf denen es zunächst um die Frage geht, wer für wen sprechen darf. Eine wichtige Frage, die aber etwas an der Funktionsweise von Texten vorbeigeht. An deren Gewebe, der Textur der Stimmen, den Hallräumen, der Vielsprachigkeit und der Hegemonialität von Sprachen. Welche Sprachen leben alleine in mir, beherrschen mich? Und dann spricht man ja zudem auch noch ständig miteinander! Martin Seel hat in seinem neuen sprachphilosophischen Buch geschrieben: »Spiele der Sprache spielt man nicht allein, selbst wenn man sie alleine spielt.« Und: »Die Spiele der Sprache sind Spiele der Sprachen. Alleine eine Sprache wäre noch keine.« Ist damit das gemeint, was mich in den Fingern hat, das, was ich oft genug auszubuchstabieren angehalten bin, jene Kräfte, Codes, Systeme und Fachsprachen, jenes Gegenüber, welches mich gerade nervt oder erfreut. Diese sehr einfachen, fast schulmeisterlichen Statements von Martin Seel mit Wittgensteinschen Anklängen führen einen auf den Pfad der Vielheit, der Multitude, wie man das noch vor zehn Jahren gesagt hat, des Pluralen. Ein »Wir« mag man heute schlecht daraus konstruieren, es wäre heute schon immer ein aus dem Ausschluss anderer Konstruiertes, Ausdruck jenes demokratischen Paradoxes, das uns der Soziologe Stephan Lessenich vorgeführt hat. Ein schlechtes Wir, das ein anderes herbeisehnen lässt, und doch unumgänglich. Wir sind ja keine Ansammlung von Ichs, die sich aussprechen können, sondern durch soziale, juristische und politökonomische Strukturen aneinander gebunden. Und Sprache ist ein Medium, das das ziemlich gut herstellen wie zeigen kann.
So, liebes Publikum: Ich sagen und los geht’s, open mike. Tell your story. Schön wärs. Wärs schön? Nein, manchmal ist es nicht schön. Und manchmal folgt man damit unfreiwillig der Logik des Spektakels, die alles aushebelt.
Bis vor kurzem galt als literarische Tugend, die mir entgleitenden Dinge zu benennen. Ambivalenzen, Dilemmata, Verstrickungen freizulegen. Literatur ist Ambivalenzerzeugung. Doch wie geht das in einer Zeit, in der von außen immer mehr Procontraäußerungen erwartet werden? Thumbs up. Daumen runter. Der politische Druck wächst, und unzuverlässiges Erzählen, Spiel mit dem ungesicherten Wissen, die Taktik, Dinge in einem erneuten selbst zweifelhaften Licht erscheinen zu lassen, all diese Unzuverlässigkeitsstrategien haben an Wert verloren. Gesichertes Wissen an Wert gewonnen, auch wenn es diametral zu anderen Äußerungen gestellt wird. Zu sagen: Ich weiß nicht, ist problematisch.
Ambivalenz ist etwas, das seit einiger Zeit politisch benutzt wird. In der Debatte um den Klimawandel wurde sie lange von Leugnern inszeniert, um die politische Handlung zu unterbrechen. Sie hat ihre Unschuld verloren. Das Zweifeln hat zwar ein Wissenschaftler wie Christian Drosten wieder salonfähig gemacht, etwas von zwei Seiten zu sehen hat aber längst nicht mehr den guten Ruf wie vor einigen Jahren. Zuviel wurden die »zwei Seiten« medial konstruiert, als agonales Gegenüber, oft sachlich fahrlässig. Deutlichkeit wird heute gefordert. Schon wieder die klare Haltung, am besten in einer reinen Sprache. Doch: »Eine wahre und reine Sprache kann es nicht geben; in ihr wäre die Differenz von Wahr und Falsch, Gelingen und Misslingen gelöscht, und damit alles, wozu sie die Sprechenden befähigt.« Dieses Zitat von Martin Seel muss ich mir heute neu übersetzen.
Ja … Wer bestimmt eigentlich, was ich erzähle? Vielleicht lass ich mich auch von so etwas Alltäglichem wie der Logik der Witze treiben, von Musik, der Form, die etwas hervorbringt. Die Metrik, das Taktgefühl im musikalischen Sinn übernimmt dann. Beim Witzerzählen z.B. ist Timing alles, die Textökonomie muss stimmen – ein Wort zuviel kann zerstörerisch sein, es braucht eine Pointe, Anspannung und Spannung, und die Reaktion ist Lachen, das körperlich wird, und wenn man Glück hat, entsteht gemeinsames Lachen, denn Lachen ist ansteckend. In der großen Familie der Komik ist Humor eine Gruppengeschäft, und es gibt nichts Übleres als ausbleibendes Lachen. Dennoch, so wird gesagt, sind Schriftsteller Einzelfiguren. Stimmt das? Bin ich wirklich alleine, wenn ich schreibe? Man wird im Schreiben schnell den eigenen Bevölkerungszustand bemerken müssen, ich suche z.B. in Gesprächen die Erfahrung anderer, arbeite mit Gegenüber, aber in der Frage, für wen ich eigentlich schreibe – eine Frage, die uns Schreibenden verblüffend oft gestellt wird und genauso oft verblüffend beantwortet wird (eben hat Uljana Wolf Kim Hyesoons Antwort zitiert: »Für ein Kind, das in 3000 Jahren geboren wird«), muss ich sagen: Für mich. Und das ist die im Zeitalter der Zielgruppenevaluation vermeintlich unberechtigste, aber ehrlichste Antwort. Sie bedeutet nicht, dass ich die deutsche Mehrheitsgesellschaft bin. Oder egomanisch. (Oder provokativ: William Gaddis »Damit ich im Alter was zum Lesen habe.«) Sie bedeutet aber, dass ich mich in Frage stelle, dass ich das fernste Kommunikationsziel werden kann und oft auch muss und vor allem: dass ich nicht alles immer schon von vornherein weiß. Diese Form des Nichtwissens möchte ich bewahren, selbst gegen jede Form der Haltung oder Entschlossenheit, sie muss irgendwo auftauchen, denn sie ist das Herz der literarischen Arbeit und die Ermöglichung von ästhetischer Erfahrung.