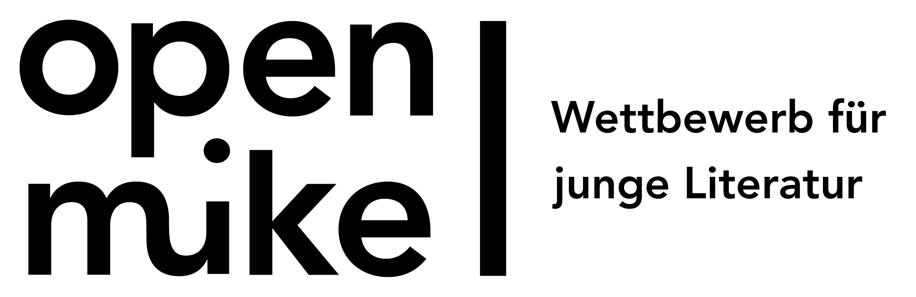Lisa Memmelers Gedichte befinden sich in ständiger Bewegung – trotz der Tatsache, dass das lyrische Ich meist stillsteht.
Zerstreut durch Zeit, Kommas und zögerliche – wenn auch lebendige – Evokationen auf Berührungen stellen diese Gedichte Versuche dar, ein »Du« oder »Wir« in der Sprache zu erfassen, trianguliert durch das Greifbare der natürlichen Welt, die sie durchdringen (Hyazinthen, einem »purpurnen« Steinkrug, Moos, Steine und mehr). Auf diese Weise heben die Gedichte den Unterschied zwischen abstrakter und konkreter Sprache auf. Sie plädieren stattdessen für eine Intimität zwischen Sprache und Erfahrung – und zwischen einem Ich und einem Du.
Im ersten Gedicht »Zeitensprung, / pandemisch« stellt das Ich eine einfache Frage: »ist es nicht seltsam, / dass dann, als wir / zu sprechen begannen, / die welt anhält?« Sobald das Ich sprechen kann, sobald es in der Lage ist, mit einem Adressaten zu kommunizieren, erstarrt die Welt: Was einst flüchtig und beweglich war, ist nun »zaeh wie fließendes / gestein, haeute gluhende / anthrazits«. Von Paradoxien durchzogen sehnen sich Memmelers Gedichte sowohl nach Biegsamkeit als auch nach Festigkeit, letztlich nach einer diskursiven Stabilität, die nur durch die Verschiebungen eines mäandernden Selbstgesprächs möglich ist.
In vielen Gedichten erkundet das Ich die Fähigkeit der Lyrik, Erfahrung festzuhalten. Der Titel des Gedichts »was sich nicht mehr singen lässt« evoziert die musikalisch-etymologische Untermauerung der Lyrik selbst. Indem es einen Zustand beschreibt, in dem »wir / Schaum sind auf Wellen«, erkennt das Ich nichtsdestotrotz, dass »[…] Du bist«. Das Vorhandensein einer anderen Person, zu der man sprechen kann, reicht aus, um die »Suche nach niemals / Gesungenem« zu rechtfertigen. Das Gedicht sucht nach einer Sprache, die sowohl ethisch gebunden als auch intim ist.
Und doch ist der Fokus auf einen Anderen sowohl in der Nähe als auch in der Ferne zwingend notwendig: »hoer doch genauer hin——« fordert Memmelers Sprecher*in später. Dann wechselt diese (kursiv gesetzte) Stimme den Kurs: »hoer lieber weg«. Weghören bedeutet in diesem Fall nicht nur, nicht hinzuhören, sondern weiter weg zu hören, näher an das, was weit weg sein mag.
Im Gedicht »im bus« spricht das lyrische Ich zunächst die Schwalben außerhalb des Fensters an – das kollektive Gebilde, das sich dem (vermeintlichen) Kollektiv der gemeinsam im Bus fahrenden Menschen entzieht. Zusammengesetzt aus einzelnen Teilen, einzelnen Schwalben, vermag dieses Kollektiv dennoch ein kohärentes »wir« zu artikulieren, eines, das »ist ein ich […] ganz ohne / kanten«. Das Gedicht endet mit einer melancholischen Feststellung: »nicht einfach ist es / ein wort zu fassen, / in diesem bewegten raum / voller aussicht, in der / doch kein wir / entstehen will, wendet sie / sich an ein morgen«.