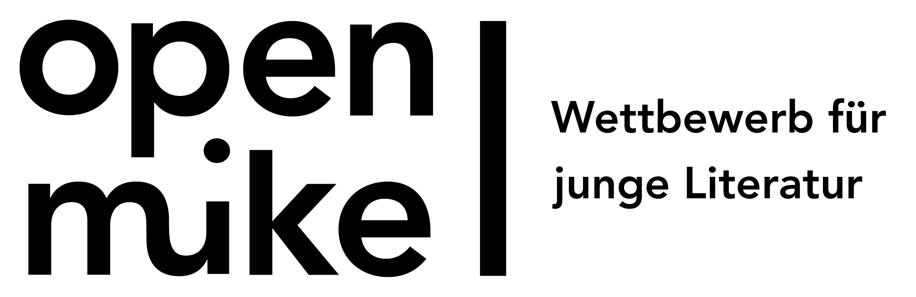Mensch und Tier finden in den Gedichten von Sophia Klink gefährlich nah zueinander, bilden eine Symbiose, die zurück und gleichzeitig nach vorne weist.
Seeschmetterlinge (Limacina helicina)
Die Wale sagen
sie hätten zu große Ohren
das ergäbe keine schönen Schlüsselanhänger
bis die Säure durch die Ohren scheint
schmollen die Wale
Blattschnecken (Elysia viridis)
Sie tragen grüne Hüte aus Samt
sie haben gelernt zu klauen
vom Kopf einer anderen Frau
die Hutbänder nähen sie selbst
irgendwann werden sie eigene Hüte tragen
Veilchenschnecken (Janthina janthina)
Sie bauen Floße
unter den Wellen
die Löffel gezückt
flößen sich Quallen ein
um nicht mehr seekrank zu sein
In langen wie kurzen Formen kommen die Gedichte von Sophia Klink daher. Sie sind überschrieben mit Affenzucker, dem Namen des ersten Gedichts. Schon in diesem Namen ist die Form der Symbiose zu erkennen. Das Tier, der Affe, zieht sich mit dem Zucker zusammen, den die Menschen ihm sprichwörtlich geben sollen. Verschmilzt zum Affenzucker, »in schmalen Spalten«. Es könnten Äpfel genauso sein, doch die umgebenden Vokabeln kommen gänzlich aus dem Bergbau, als müsste der Zucker herausgebrochen werden aus einem Flöz.
In den kleinen Gedichten zu Meerestieren, die wie Lexikonminiaturen daherkommen, sich dieser Form aber gleichzeitig widersetzen, vermenschlichen sich die Tiere. Sie lästern, schmollen, nähen sich Hutbänder, werden seekrank auf selbstgebauten Floßen. Die Vermenschlichung zeigt jedoch zugleich auch in die andere Richtung, die schmerzhafte: Denn wie Tiere voller Humor spielerisch zu Menschen werden, da werden sie gleichzeitig zum Platzhalter. Nämlich da, wo das Experiment am Menschen zu riskant wäre, ethisch nicht vertretbar – da nehmen die Tiere den Platz der Menschen ein.
Die Gedichte in Affenzucker nehmen beide Richtungen auf und transportieren sie in einem leichten Rhythmus, kurzen Satzstrukturen, die für sich prosaisch wirken. Doch die hart aufeinandertreffenden, teilweise surreal wirkenden Reihungen eröffnen den lyrischen Raum, weiten das Sprechen. So üben die Gedichte Kritik am Verhältnis des Menschen zum Tier, zur Natur, ohne sich höher zu stellen. Sie betonen das Kreatürliche, Körperliche des Menschen, und damit seine tierische Seite über der kulturellen, die fast entstellt erscheint.