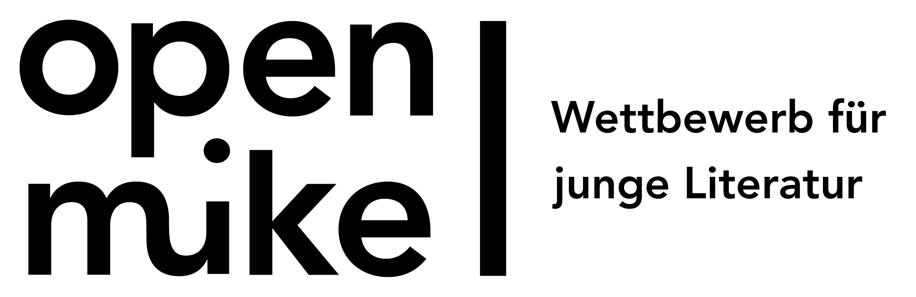Auszug aus der Kurzgeschichte »Neue Menschen«
Ich habe also diesen Freund. Andreas. Andreas schlägt immer irgendwelche Sachen vor, von denen wir beide wissen, dass wir sie sowieso nicht machen.
Sollen wir uns nicht einen Hund kaufen? Los, wir machen eine Bar auf! Komm, wir ziehen auf’s Land!
Jetzt bin ich hier, und es riecht nach nassen Socken, warmen Füßen, altem Schweiß. Und neuem Schweiß. Das ist meiner.
Ey, lass mal Yoga bei 40 Grad machen!, hatte Andreas gerufen, und ich geglaubt, er meine es diesmal ernst.
Ich bin einfach zu verbindlich.
In mir fehlt einer, der nur in diesem einen bestimmten Moment glaubt, was er sagt. Und danach wieder etwas anderes.
Wie Andreas.
Nun läuft mir also der Schweiß von der Stirn, als schäme er sich und wolle weg von mir. Nur kommt er nicht weit. Er perlt an meiner Nasenspitze ab, landet auf meinen Lippen, schmeckt nach Salz. Auch der Mann neben mir keucht. Er trägt eine weiße Feinrippunterhose und ein schwarzes T-Shirt, darauf ein Panda-Bär. Die Unterhose ist schon durchsichtig, der Panda klebt fest auf der Brust. Auf dem Rücken des Mannes steht: Don’t be racist, be Panda! He’s black, he’s white, he’s Asian.
Die Frau vor uns hat keine Schweißdrüsen, trägt einen Bikini und sieht gelangweilt aus. Als seien hier keine 40 Grad, als bekäme man keinen knallroten Kopf, als würde einem nicht schwarz vor Augen. Ich liege schon wieder auf der Matte, während sie und die anderen sich verknoten und verdrehen, als müssten sie dringend aufs Klo, wollten dabei aber beten und Gott oder Buddha um etwas bitten, vielleicht Klopapier oder einen Kopfschuss. Ich hasse Andreas. Dabei bin ich ein friedlicher Mensch. Friedlich. Verbindlich. Untrainiert.
Let go!, ruft die Lehrerin, und ich weiß nicht, ob sie den Hass meint oder die Verspannung im unteren Rücken. Der Panda-Mann neben mir stöhnt, aber es klingt weit weg. So wie die Stimme der Lehrerin. Sie ist irgendwo über mir, im Raum oder im Himmel, ich selbst bin in der Hölle, in meinem Ohr rauscht es, in meinem Kopf dröhnt es. Von der Lehrerin sehe ich nur rote Zehennägel und einen schmalen Fußknöchel. Er schwebt an mir vorüber, und auf diesem Yoga-Lehrerinnen-Fußknöchel steht Zuhause. Zuhause in schwarzer Schreibschrift, als wäre der Weltfrieden nur ein esoterisches Tattoo entfernt, und das einzige, das ich den Rest der Stunde noch denken kann, ist, dass Andreas genau dort ist: Zuhause. Und ich bin hier und hasse ihn, hasse ihn, hasse ihn.
Let go! Let go! Let! Go!
Mir ist immer noch schwindlig, als mir die Lehrerin eine Tasse Tee reicht, der nach Füßen schmeckt. Detox-Tee, sagt jemand. Die übrigen Teilnehmer wirken gar nicht so, als hätten sie 90 Minuten ihren Körper in alle Richtungen gestreckt und drei Liter Schweiß vergossen. Nur ich und der Panda-Mann sehen aus wie dieses Männchen von Edvard Munch. Der Schrei?
Es tut gut, zu sitzen.
Und dass vor dem Übungsraum keine Spiegel mehr hängen.
Mein Blick fällt auf Buddha neben der Wasserkaraffe, klein, dick, golden, die Augen Schlitze, er freut sich. Vielleicht lacht er uns auch aus. Seine Hände sind zu einer Schale geformt, darin glitzern Centstücke. Trinkgeld fürs Schwitzen?