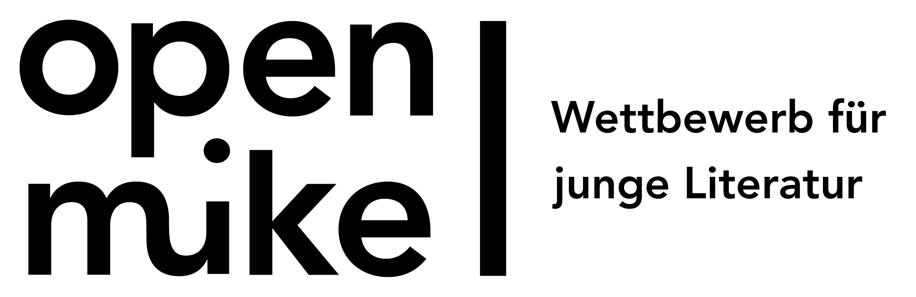Die Straße ist ein Jagdgebiet, offenes Feld, ein paar müssen die Hasen spielen − kleine, wilde, leicht erlegbare Tiere − und der Rest ist hungrig, ja alle sind sie, hungrig wie noch nie. Und Opa ist ein Hase, plötzlich muss er ein Hase sein.
Astrid Ebner erzählt in Janes’ Nacht fragmentarisch die Geschichte einer existenziellen Bedrohung durch zwei Ich-Erzähler in einem totalitären Regime – mutmaßlich die NS-Zeit, genau benannt wird sie nicht.
Der eine ist der Enkel, der durch die Augen seines Großvaters von dessen Überleben als Unterdrücktem berichtet. Gleich zu Beginn tritt ein Stiefelchor auf, der bedrohlich durch den Text marschiert und den Rhythmus wie die Stimmung setzt. Dass der Großvater überlebt ist klar, ansonsten gäbe es ja den Enkel nicht. Aber darum geht es nicht. In dichten, rhythmischen Sätzen gibt Astrid Ebner Einblick in die Gedanken und Strategien eines Menschen, der um sein Überleben kämpft.
Dabei zeichnet sie stimmungsvolle Bilder von der Umgebung des Großvaters, wie Nachbarn sich gegen ihn stellen, wie andere zu ihm halten und letztendlich nur das Glück sein Überleben sichert.
Durch ihr verwobenes Erzählen ist man immer nah dran, sowohl am Enkel als auch am Großvater. Man verschwimmt geradezu mit ihnen, sodass man die Spannung fast körperlich spürt, die durch die Nähe zu den Figuren aufbaut wird. Und das ist auch die große literarische Stärke dieses Textes: Es ist, als ob man selbst verfolgt und plötzlich, erst ganz zum Schuss, freigegeben wird.
So poetisch der Text geschrieben ist, so kräftig liest die Autorin. Was an manchen Stellen den Rhythmus des Textes durchbricht. Dennoch, ein sehr starker zweiter Auftritt.