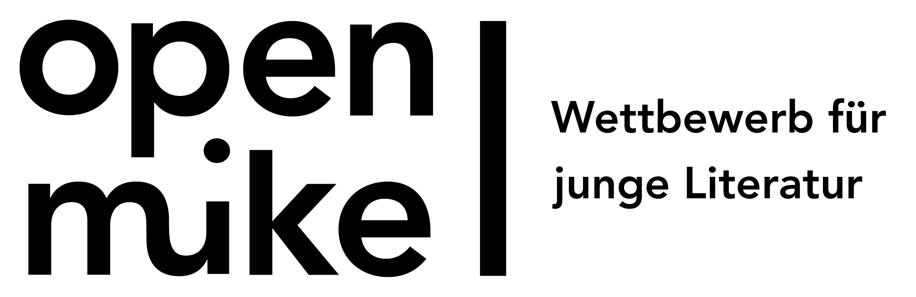Literaturwettbewerbe und -preise haben sich im 20. Jahrhundert zum integralen Bestandteil des Literaturbetriebs entwickelt. In ihrer Wirkung liegt ein Versprechen auf zukünftige oder gegenwärtige Größe, pragmatisch akkumulieren sie Aufmerksamkeit und verfügen über eine mäzenatische Funktion. Die Möglichkeit mit Buchverkäufen zu überleben ist vielleicht noch einem Daniel Kehlmann vergönnt, alle anderen sind auf Preise angewiesen. Mäzenatische Strukturen gab es freilich schon immer: Vom Mäzenen selbst bis zu den Hörspielen der Nachkriegszeit mussten immer wieder Subventionsformen gefunden werden, um Autoren das Überleben zu sichern. Bei Literaturpreisen kommt jedoch ein entscheidender Faktor dazu: Sie schaffen sehr schnelle, aber auch sehr flüchtige Aufmerksamkeit. Das plötzlich über den Autor gekommene Aufmerksamkeitskapital muss möglichst schnell in eine Publikation münden, obwohl die Mühlen der Literatur langsam mahlen. Doch selbst wenn es gelingt: Sich dauerhaft zu etablieren, ist vielleicht die wirkliche Kür nach dem ersten Erfolg.
Kritik an solchen Preisen wurde immer wieder formuliert. Stellvertretend dafür Oliver Jungen 2008 in der FAZ:
Kurz: Es gibt in Deutschland mehr Preise als Schriftsteller, und die meisten werden auch noch jährlich vergeben. Das Ergebnis ist ein Wanderzirkus: Literaten auf Lorbeersammeltour durch die Republik. Die Kehrseite dieser Inflation ist die Entwertung der Währung Schriftstellerlob. Wie kam es dazu? Wie meistens: durch einen Systemfehler. Die Preisschwemme nämlich stellt nur den sicht- und meldbaren Teil einer viel gewaltigeren Subventionsverschwörung dar. Diese beruht, das ist der eigentliche Skandal, auf einer herablassenden Prämisse: Literatur gilt als Pflegefall. Man versüßt der tatterigen Tante den Lebensabend.
Doch darum soll es nicht gehen. Der open mike nimmt in diesem Kontext einen Sonderstatus ein, da er meist den ersten Preis in der Karriere eines Schriftstellers markiert. Die Frage, die sich deswegen stellt: Wie wirkt sich der Gewinn des open mikes auf die Karriere eines Jungautors aus? Kann man eine Aussage darüber treffen, ob er sich in den meisten Fällen positiv oder womöglich auch negativ auswirkt? Daher ein beispielhafter Blick in die Vergangenheit des Wettbewerbs:
Man mag richtig vermuten, wenn man konstatiert, Lyriker seien in besonderer Weise auf Preise angewiesen und haben es auch im Anschluss besonders schwer, ihre Dichterexistenz auf ökonomisch gesunde Füße zu stellen. Wie aus dem open mike ein Lyriker hervortreten kann, der für diese Schwierigkeit ein geschärftes Bewusstsein hat, zeigt der Fall Ulf Stolterfoth. Er war 1994 – im überhaupt erst zweiten Jahrgang des Wettbewerbs – einer der drei Sieger. Mit seinen dreißig Jahren gehörte er schon damals nicht unbedingt zu den klassischen Newcomern und wenn man bedenkt, dass seine erste Publikation „fachsprachen I-IX“ erst fünf Jahre später in der Urs Engeler Edition erschien, dann ergibt sich eine Ahnung davon, dass die Aufmerksamkeitspolitik in der Literaturbranche eine prekäre Angelegenheit ist: Die Textproduktion lässt sich nicht so planen, wie die erste Single nach dem Gewinn von DSDS. Stolterfoth publizierte in regelmäßigen Abstand weiter, bis er schließlich in den 2010er Jahren den Brueterich Press-Verlag aufbaut. Er zieht die logische Konsequenz aus einem Missverhältnis, das gerade in der Lyrikbranche herrscht: Man kann junge Talente noch so sehr mit Preisen überhäufen; wenn dahinter keine verlegerische Infrastruktur steht, die die entstandenen Texte zur Publikation bringen und weitere Schritte betreuen, sind die Auszeichnungen alles und nichts. Deswegen, so beschreibt es Marie Luise Knott im Tagespiegel, herrscht bei Brueterich die Maxime: „Gedruckt wird alles, womit er sich gerne verbinden möchte. Und: Gedruckt wird, solange das Geld reicht.“
Dass der Gewinn des open mikes nicht immer die große Verlagskarriere bedeutet, beweisen Beispiele wie Katharina Schwanbeck. Sie gehört zu 2006er Jahrgang, in dessen Jury der streitbare Maxim Biller saß. Der kam in seinem Schlusswort zu einem ernüchterten Fazit: „Es gab keine Geschichte, von der ich hätte wissen wollen, wie sie ausgeht.“ Ob es mit dem Biller’schen Richtspruch oder getroffenen oder ausgebliebenen Entscheidungen zusammenhängt: Auf die erste Romanpublikation muss der geneigte Leser immer noch warten. Zwischendurch gab es zwar kleinere Veröffentlichungen in Anthologien und Zeitschriften, aber eine eigenständige Publikation ist schließlich immer noch die Königsdisziplin im literarischen Betrieb. So hat sie das Schreiben auf ihren Blog „tell me your secret“ verlegt. Damit hat sie – scheinbar – einen sehr zeitgenössischen Weg eingeschlagen, der jedoch der Aufmerksamkeitspolitik eines Literaturpreises diametral entgegensteht. Preise und Publikation erzeugen punktuelles Echo, während Blogs sich langsam eine treue Leserschaft heranzüchten müssen. Und sie kommen in den relevanten Medien der Literaturkritik auch nicht vor, trotz der Großblogger Goetz und Herrndorf.
Der open mike kann aber auch für das Höchste empfehlen: 1997 gewann unter anderen Terézia Mora den Wettbewerb. 16 Jahre später wurde ihr einer der wichtigsten Würden zugetragen: Der Deutsche Buchpreis für den Roman „Das Ungeheuer“. Man kann das als Beweis für die Wirkungsmöglichkeiten des open mikes werten, obgleich sich Mora vielleicht auch ohne Gewinn durchgesetzt hätte. Sie führt aber gleichzeitig den integrativen Effekt des Wettbewerbs vor: 1997 noch als Debütantin dabei, ist sie dieses Jahr Teil der Jury. Die 18 Jahre ältere Terézia Mora begegnet sich selbst in Form anderer junger Talente und plötzlich bekommt man ein Gefühl dafür, was dieser Preis bedeuten kann.
Was uns das sagt, dass aus Gewinnern Romanautoren, Blogger und Verleger werden? Dass man den Effekt des open mikes auch, aber nicht nur an den Publikationslisten messen sollte, die sich zehn Jahre nach einem Gewinn ergeben haben. Das Debütanten-Konzept des Wettbewerbs bringt mit sich, dass der weitere Lebensweg der Teilnehmer – unabhängig von ihrem Abschneiden – nicht vorgezeichnet ist. Die allermeisten nutzen das Treiben, um sich einen dauerhaften Erfolg aufzubauen, manche sind dem Literaturbetrieb nicht gewachsen, andere verlieren vielleicht auch die nötige Leidenschaft. Einige wenige kommen auch an die Qualität ihrer Lesung beim open mike nie wieder heran. Doch dann – so hofft man – haben sie wenigstens einen einzigen poetischen Moment geschaffen. Und das ist schon mehr als viele andere vorweisen können.