„Draußen ist Sommer, da sitzen wir Springbrunnen.“ Eine Clique im Center, zwischen Chicks-Friseur, Bubbletea-Shop und Sanipay-Klo. Ein Kosmos mit Milieu, eine Mall mit Bildungsauftrag: Aufgestellt sind Plastik-Replikate der chinesischen Tonkrieger-Armee des für Doris Anselms Text titelgebenden Königs Ying Zheng. Ein Monat noch, dann soll das Center geschlossen werden. Also Brief ans Management geplant: „Wir machen so Volksbegehren, Dicker. Mit Demokratie. – Demokratie deine Mutter.“ Das beste Argument ist was mit Bildung, denken sich die lebensklugen Bald-Verlierer in Doris Anselms klug rhythmisiertem Text. Also ZooMann:
„Ich schreibe: Kardinalfisch. Blauer Zwergfadenfisch. Sonnenstrahlfisch. Diese Fische können wir nur hier sehen und sonst nirgendwo anders, wir schwören.“
Weil das Center keinen Briefkasten mehr hat, nur eine Adresse in China, macht sich die Crew auf den Weg ins 4. OG, um dem Management mit ihrer Eingabe persönlich gegenüberzutreten. Ein langer Flur ohne Marmor, offene Spinde, hinter allen den Türen nur noch Müll oder nichts. Eine Tür verschlossen: das Zentrum der Macht, und die Bittsteller stehen gerade und still wie die Tonkrieger. Klopfen traut sich keiner von ihnen. Brief unter der Tür durch:
„Dann gehen wir. Gehen wir nacheinander die grüne Treppe runter und sagt keiner ein Wort. Die Treppe runter dauert zehnmal so lange wie rauf.“
Die Krieger, die mit dem unbekannten Center-Management weichen werden wie die chinesische Armee mit ihrem Führer unterging, ziehen sich zurück.
Doris Anselm stellt politische Fragen und verleiht den sonst Unsichtbaren ein Gesicht: Anders als die kafkaesk gesichtslose Macht hinter der verschlossenen Tür besteht das Fußvolk aus Individuen. Jeder (Plaste-)Krieger sieht anders aus. „Archäologen halten es deshalb für möglich, dass jede einzelne Figur einem ganz bestimmten, damals lebenden Soldaten nachgebildet wurde.“ Der König verneigt sich und tötet? Grandios. Ergo: Favoritin! Die hochdeutsch gelesene Kanasprak hin oder her.
***
Leseprob: Doris Anselm; Die Krieger des Königs Ying Zheng
Draußen ist Sommer, da sitzen wir Springbrunnen. Mit Klimaanlage. Sonst ist nicht anders als Winter. Wir sind hier. Alles ist hier. Für Essen, für Trinken, für Schönsein, für Kranksein, für Schenken. Gibt welche von uns, die waren schon hier vorletzten Sommer und davor sogar. Die sind hier aufgewachsen, wir schwören. Vorn eine Sitzbank, da haben wir paarmal Hausaufgaben gemacht. Aber die Zettel nehmen Platz weg für andere Leute, sagt Center. Ein Zettel, das geht. Ein Brief schreiben, das geht.
Die Stimme von Center kommt, wenn du Fehler machst. Und wenn auch jemand was verliert. Ein Kind. Eine Tasche. Du kannst die Stimme gut verstehen. Center sagt nicht: Gleich passiert was komm hau ab du Missgeburt. Center sagt: Dies ist ein rauchfreies Center. Wir gehen für Rauchen nach draußen. Nicht oft. Es stinkt da und meistens regnet oder ist heiß. Meistens keiner hat Zigaretten. Die Penner warten vor der Tür und wollen unsere aufrauchen. Wir können wieder rein. Jetzt noch, ein Monat. Aber deshalb wir machen den Brief und deshalb ist Streit. Wer muss den Brief schreiben? Ich. Die anderen sagen mir wie.
– Mach nicht so. So denken die, kann keiner richtig schreiben
hier.
– Denken sie eh.
– Kann ja auch keiner.
– Wir machen so Volksbegehren, Dicker. Mit Demokratie.
– Demokratie deine Mutter.
– Fick dich.
– Schreib das mal mit Natur.
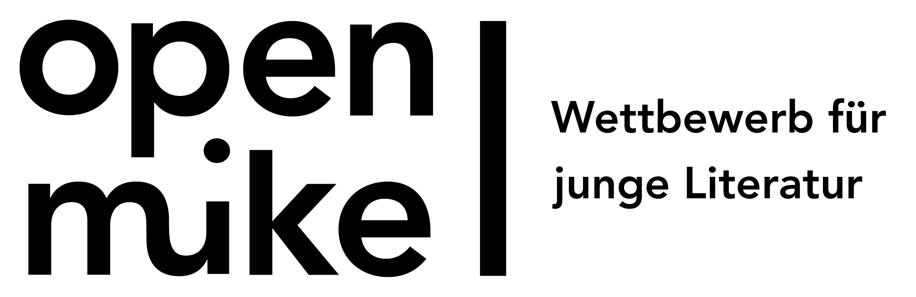

2 Gedanken zu “Doris Anselm: „Die Krieger des Königs Ying Zheng“”
sehr gespannt war ich auf den text dieser autorin.
fuer sich stehend empfinde ich ihn als kohärent, experimentell, ein bisschen wie eine moderne fabel. dass das auf mehreren seiten funktionieren kann, werde ich wohl leider erst mit ende des wettbewerbs feststellen duerfen.
keine ahnung, ob´s jemanden interessiert. wir leben im virtuellen zeitalter, da darf jeder seinen senf dazugeben…:D
Um dem Konsens etwas entgegen zu halten; ich habe den Text bisher nicht lesen können, nur die wenigen Zeilen auf dieser Seite. Die Idee mit den chinesischen Tonkriegern in dem Einkaufs- Center finde ich durchaus schön, frage mich aber, ob sie als Überhöhung schon genügt, um einem Realitätsanspruch entgegen zu wirken, wie man ihn heutzutage leider in vielen Texten findet. Die Sprache übernimmt den vergeblichen Versuch, Sprache als Zeichen für ein bestimmtes Milieu nachzuahmen. Mir fällt in der Literatur jetzt kein gelungenes Gegenbeispiel ein, nur im Film: die Sprache der Jugendlichen an der Banlieue von Paris in „L’Esquive“ von Abdelalatif Kechiche wird in ihrem Rhythmus beinahe zu einer Kunstsprache, vergleichbar den Versen von Marivaux, die wie selbstverständlich in dem selben Kosmos existieren dürfen. Die Autorin Anselm scheint es sich (auf den ersten Eindruck, zugegeben) dagegen ein wenig einfacher zu machen.