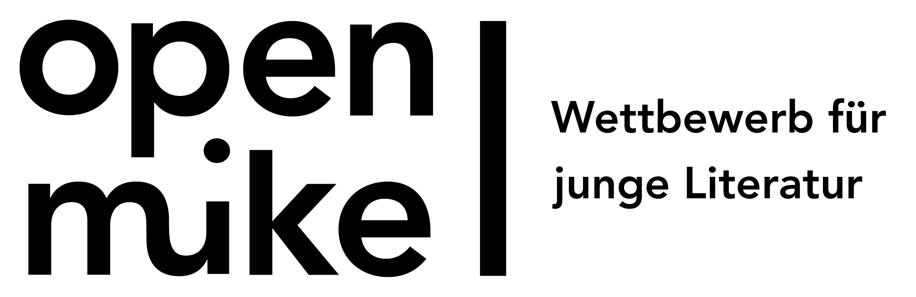Es war einmal ein Wesen, ein Mensch, ein junger Mann, wenn man es so nennen will, und dieses schrieb eine Geschichte auf, an einem Sonntagnachmittag, und am folgenden Montag steckte es die Geschichte in ein Kuvert und das Kuvert brachte es zur Post und die Post das Kuvert nach Berlin, wo die Geschichte sich für einen Geschichtenwettbewerb empfehlen sollte.
An einem schönen sonnigen Tag, später, da saß es bei Kaffee und Kuchen im Garten, als eine Taube angeflogen kam, aber nicht irgendeine, nein, eine Brieftaube, sie kam aus Berlin und brachte gute Neuigkeiten. Das Wesen fiel aus einigen Wolken, und wollte ab da nicht mehr als Wesen verniedlicht werden, deshalb nenne ich es im Folgenden: Autor, weil es hier um das Wesen als Autor geht, was es schließlich auch war, hatte es doch diese Geschichte aufgeschrieben.
Irgendwann später saß er dann auf einer Bühne in Berlin, der Autor, saß und las seine Geschichte, vor Publikum und wie die Stimme immer wegrutschen wollte, aus Nervositätsgründen.
Seine Geschichte handelte von einem jungen Mann, ein Ich-Erzähler, der jemanden vermisste. Der Ich-Erzähler hatte sich verliebt, und das ausgerechnet während einer Chemotherapie, nämlich seiner eigenen. Man begleitete den Ich-Erzähler also eine Weile durch die Behandlung und blickte am Ende mit ihm zurück, als er versucht einzuordnen und sich zu emanzipieren, vom Vermissten und auch dieser ganzen elendigen Krankheitsgeschichte, die doch jetzt auch einfach mal vorbei sein sollte.
Später, nach der Lesung, wurde dem Autor immer wieder die gleiche Frage gestellt: Ist diese Geschichte autobiografisch?
Er erschrak etwas, da er sich im Vorhinein keine kluge Antwort überlegt hatte, heute würde er vielleicht entgegnen: ja, ich lebe. Denn alles was er schrieb und schreibt, das kommt ja von irgendwoher. Das hat er mindestens mal gedacht oder gehört und höchstens selbst erlebt.
Ja, er lebt.
Und dann dachte er: Was würde die Beantwortung der Frage, die man zweifelsohne stellen dürfen soll, denn nachträglich ändern an der Geschichte, die jetzt nun mal da war?
Nichts. (Nichts. Nichts. Nichts.)
Eine große Zeitung beschrieb die vorgetragene Geschichte des Autors mit einem Begriff, den man im kulinarischen Bereich für eine Füllung von Fleisch- und Fischgerichten verwendet und reduzierte den Ich-Erzähler auf seine angebliche Mitgliedschaft einer verspotteten angeblichen Subkultur des 21. Jahrhunderts. Eigentlich war es gar nicht die große Zeitung, sondern eine freie Mitarbeiterin ebendieser, die hier und da was im Namen der großen Zeitung zerpflücken durfte. Während des Wettbewerbs gähnte sie angeblich sehr viel, vielleicht war sie nicht ganz ausgeschlafen.
Der Autor tat, was man nicht tut, er schickte der freien Mitarbeiterin ein Telegramm, keine Taube, er fragte, was sie denn genau meinte, da in ihrem Artikel nur dieser recht unausgeschlafen anmutende Halbsatz zu seiner Geschichte fiel.
Die freie Mitarbeiterin antwortete sehr ausführlich, und um es auf das Wesentliche zu reduzieren: sie fand den Text gut, gestand sie, gut gearbeitet, aber schlecht recherchiert. Sie erklärte dem Autor, wie das zu funktionieren hätte, mit dem Krebs, und das man dann, wenn man nämlich Krebs hat, zum Beispiel nicht dem Psychoonkologen auf den Hintern schaut, wie es der Ich-Erzähler in der Geschichte tut. Nein, schrieb sie, es sei sogar respektlos allen Betroffenen gegenüber, eine so schlimme Krankheit so dermaßen zu verniedlichen.
Und selbst wenn die Geschichte autobiografisch wäre, was, wie wir wissen, nichts (nichts, nichts, nichts) ändern würde, hätte der Autor eine Verantwortung gegenüber allen Erkrankten, die eben nicht um fünf Uhr früh über feuchte Wiesen sprangen wie sein betroffener Ich- Erzähler.
Der Autor schrieb der freien Mitarbeiterin nicht mehr zurück. Einfach, weil er über das nachdachte, was sie da geschrieben hatte: nämlich, dass er seine Geschichte nicht erzählen dürfe.
Seine Geschichte, weil er sie mindestens erdacht und höchstens selbst erlebt hat. Eine Geschichte, angeblich so überzogen, dass sie nicht erlebt sein kann. Das erschreckte den Autor, kurz, und dann freute er sich ein bisschen, darüber, dass er Andere erschrecken konnte, erwischen, hier oder dort.
Der Autor nahm sich vor, eine Geschichte aufzuschreiben, seine Geschichte, die ganze. Und zwar so, wie er es will. Ohne falsche Rücksicht auf Wesen, die vielleicht eine ähnliche Geschichte anders erlebt haben. Gerade für Wesen, die eine ähnliche Geschichte ganz anders erleben, könnte seine Geschichte doch relevant oder zumindest interessant sein.
Vielleicht auch nicht.
Eine Geschichte aus der Sicht eines Erkrankten, die über den Tellerrand der Krankheit schaut: keine Geschichte der Krankheit, sondern eine der Heilung, denn das erkrankte Wesen ist ja auch eins, das liebt und vielleicht Kuchen isst und natürlich auch Angst hat und genau aus dieser Angst heraus kreativ wird, es bebt vor Lebenslust (wann soll man stärker vor Lebenslust beben als ab dem Moment, in welchem das Leben nicht mehr als selbstverständlich erscheint?) und springt später einmal um 5 Uhr früh nackt über eine Wiese.
Manchmal gähnt es auch, aber es verbietet sich nichts, und lässt sich auch nichts verbieten, von anderen gähnenden Wesen, deren Geschichte genauso stimmt oder nicht stimmt wie meine. Ich meine: seine.
(Gewisse Ähnlichkeiten mit tatsächlich atmenden und gähnenden Wesen sind vermutlich rein zufällig, wie das in den meisten Geschichten eben so ist.)