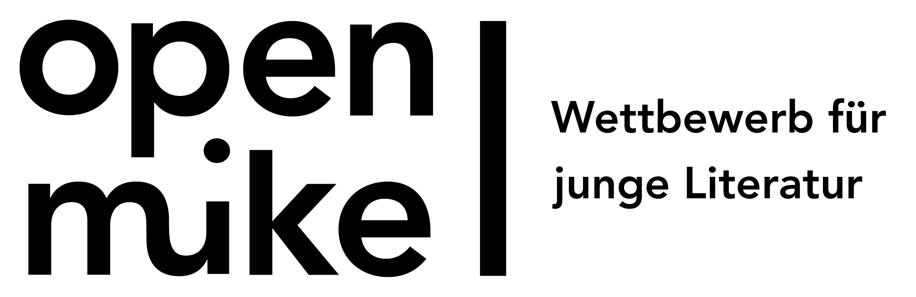Ich beginne ganz klassisch mit einem Willkommensgedicht.
Verena Fiebiger eröffnet ihre Lesung mit einem kurzen Prolog. Ihre Stimme ist sicher, fast singend bahnt sie sich ihren Weg durch die Zeilen und stellt jede auf ein Podest, einen Denkmalsockel. Sie schaut immer wieder hoch ins Publikum, aber nicht um sich seiner Aufmerksamkeit zu versichern, sondern zur eigenen Präsentation. Komisch eigentlich, dass sie noch sitzt, nicht steht.
Die Texte der Lyrikerin sind rotzig. Sie scheut sich nicht, Dinge beim Namen zu nennen, Politisches mit ein paar Zeilen anzustoßen: Nach zu viel BRD will das lyrische Ich wieder an die Ostsee. So frech, so gut.
„48 Stunden nach Acapulco“ bildet den Gipfel der Unverfrorenheit, erzählt die lolitahafte Geschichte eines Kinderschänders und eines Mädchens, die im Auto Richtung Acapulco unterwegs sind. Ein Gedicht, das erzählt, ja, auf eine simple Art und Weise. Im vierhebigen Jambus, überwiegend, nur einzelne Verse fallen raus. Da fragt man sich, ist das Absicht?, und weiß es nicht.
Ihre Lektorin, Julia Graf, hebt Verena Fiebigers Parlando-Stil positiv hervor. Doch der Grat zwischen Parlando und Marktschreierei ist schmal. Teils wirken die Gedichte aufdringlich wie Obstverkäufer, was ihren gewollt provokativen Themen und Verena Fiebigers Auftritt geschuldet ist.
Die Lyrikerin spinnt eine Geschichte um ihre Texte, verbindet sie mit kurzen Sätzen: „Wenn man die Ostsee nicht findet, bleibt man halt zu Hause.“ Ihr Vortrag ist eine ausgeklügelte Inszenierung, bis zum Ende: „Und jetzt auf Wiedersehen.“ Damit schließt sie und verlässt die Bühne, die ihre Freundin ist, ihre beste vielleicht.