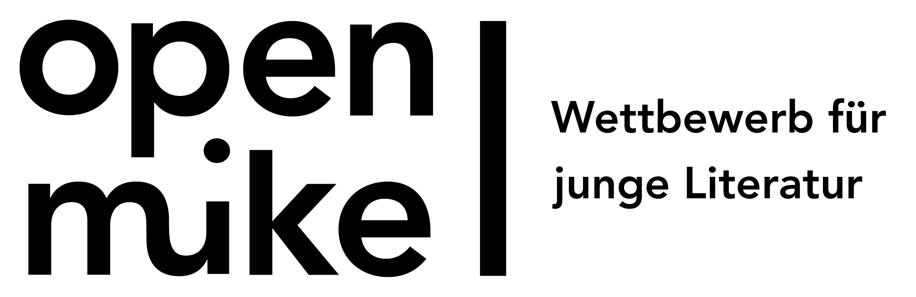Kenah Cusanit liest zunächst langsam, leise. Sie begeht ihren Text wie eine Ausgrabungsstätte. Vorsichtig, umsichtig, um nur kein Wort zu zerstören, kein Fundstück unbeachtet zu lassen.
Ein Fluss zieht sich durch den Text, an einer Grabungsstätte vorbei, und spült dabei die Sprache aus, wirft sie auf sich selbst zurück. Immer wieder „Ruhe“, „Lehm“. Der Text mäandert, wirkt wie aquarelliert, legt sich auf die Glieder wie tropische Hitze. Bewegung ist kaum möglich. Dr. Koldewey, der Protagonist, der manchmal Archäologe, manchmal Philologe ist, geht nicht, er kriecht zur Tür und schätzt dabei die Abstände falsch ein. Darum geht es: Abstände feststellen, messen, und dabei den eigenen Standpunkt ausloten.
Man mußte die Strecke zur Fliegengittertür nicht laufen, man konnte auch kriechen; der Schwerkraft des gewöhnlich aufrechtgehenden Körpers, wenn waagerecht positioniert, ein Stück Energie abgewinnen, um sie der eigenen Sprachgewalt zurückzuführen […]
Eine Fliegengittertür bewegt sich, aber es geht kein Wind, es gibt keine Abkühlung. Schlamm, Lehm, Wasser sollten Kühlung bringen, tun es aber nicht. Die Hitze bleibt undurchdringlich und ist unterlegt mit dem monotonen Klicken eines Fotoapparats – latent aggressiv, nervtötend, wie ein Schwarm summender Moskitos. Die Grabungsteilnehmer halten den Apparat wie eine „Flinte“.
Martin Kordic, der Lektor, spricht vom Wagnis einer „Prosaausgrabung“. Ein Wagnis, dessen Worte und mäandernde Sätze sich schwer auf die Zuhörer legen. Ein Wagnis, dem man sich nicht entziehen kann. Eines, das gelingt.