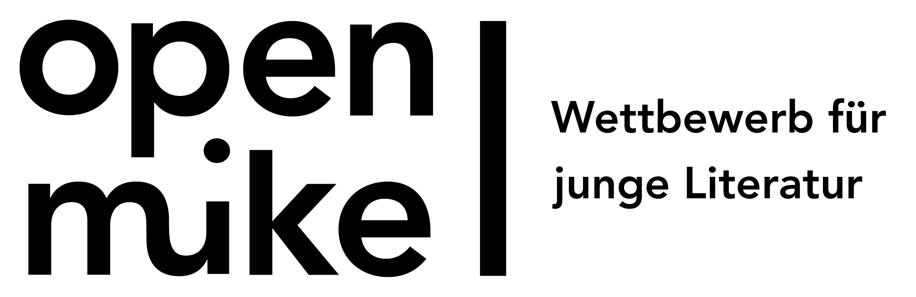Von Nikola Richter
Die Äcker sind gepflügt, die tief stehende Sonne taucht die Nadelhölzerhügel rund um Bayreuth in gelb-grelles Herbstlicht. Heute war Fön in München, und ich sah zünftige Filzjacken, aufgeknöpft, verschiedene toupierte Damen in Kaffeekränzchen an der Münchner Freiheit mit Latte Macchiato im Glas plus Strohhalm. Nun zeigt die Temperaturanzeige im Fernbus, mit dem ich gerade zurück nach Berlin fahre, noch immer angenehme 16 Grad Außentemperatur an. Hier drinnen ist es wärmer, stickiger, aber auch gemütlich. Wir zuckeln so dahin, die Fahrbahnrandbepflanzung tänzelt vorbei. Aber nicht alle schauen raus, die meisten Mitreisenden tragen Kopfhörer, einige sitzen vor aufgeklappten Laptops.
Denn dieser Fernbus hat Wlan: Die Kanäle heißen Meinfernbus1 und Meinfernbus2, und sie stehen in einer Testversion zur Verfügung wie der laminierte Infozettel verkündet: „Eingeschränkter Internetzugriff möglich und begrenzt auf 16 Personen.“ Das ist neu, ich finde es zeitgemäß, ich probiere es aus. „Nutzungsbedingungen akzeptieren, einloggen drücken und lossurfen.“ Mmh, klappt leider nicht. Aber alles nicht schlimm, denn ich habe mit meinem mobilem Internet auf der bisher dreistündigen Reise bereits viermal meine Mails gecheckt, ein bisschen Links per Facebook gelesen und geliked und einen Kommentar geschrieben, SMS verschickt und zwei Telefonate geführt. Ja, das Reisen hat sich verändert. Wer nicht weiß, dass ich gerade in einem Bus über die Autobahn schaukele, bei konstant 100 kmh, kann es meiner digitalen Aktivität kaum entnehmen. Die Zeit, in der der Reisende nach mühsamen Stunden oder Tagen in einem Gefährt an seinem Ziel ankam, um von den Erlebnissen unterwegs zu berichten, sind schon lange vorbei. Die Abschiedsrituale haben sich erledigt, wenn man gleich nach der nächsten Kurve wieder anrufen/smsen/twittern kann. Jeder Backpacker in den Anden ist online und schickt Selfies von jedem erklommenen Pass. Im Gegenzug verfassen Journalisten Selbsterfahrungsberichte von Offline-Zeiten, um das Gefühl einer analogen Vergangenheit wieder heraufzubeschwören. Dabei sind es nur Pseudo-Gefühle, es ist eine Pseudo-Versenkung, denn der nächste Browser ist ja gleich wieder offen, der nächste Sendemast steht da drüben. Das Bewusstsein ist kein analoges mehr. Und das Ich, das dieses Bewusstsein mit sich herumträgt, steht immer in einem Kommunikationsfluss. In einem Datenfluss. Aus dem heraus sich hier und da etwas abhebt.
Im englischen Twitter ist vor einigen Jahren der Begriff „Weird Twitter“ aufgetaucht: spielerische, oft dreiste, humorvolle, absurde Tweets, eine eigene literarische Twitter-Subkultur. Für das US-amerikanische Webportal Buzzfeed wurden im Stile der Oral History einige Twitterer befragt, was genau es mit dieser Schreibform auf sich habe, und ich finde besonders eine Antwort erstaunlich, denn sie spiegelt für das Schreiben im social web eine Literaturtheorie wider, Harold Blooms’ „Anxiety of Influence“, das Schreiben auf den Schultern der Vorgänger, die Evolution des Schreibens unter dem Einfluss anderer Texte, nur dass die folgende Erläuterung eher nach „Surprise of Influence“ klingt:
@tricialockwood: Wild Twitter has an enormous capacity to absorb and incorporate voices that are complementary but dissimilar. You see this when a new great tweeter comes along and suddenly people start using their tropes and vocabularies and forms! New people do not diminish it, but they add to it, they mutate it.
Das Netz ist eine Schreibmaschine. Neue Formen von Literatur und von Autorschaft finden heute unbedingt und bedingt mit dem Netz statt. Und damit meine ich nicht Jennifer Egans gutwilligen Versuch „Black Box“, frei nach dem Motto „Ich twittere jetzt mal meinen Roman und schaue, was passiert“. Denn auf Twitter war dieser Versuch für all jene, die mehr als zehn Twitterern folgen, nicht lesbar. Zudem zeigte ihr Kanal keine Interaktion, er entwickelte sich nicht mit dem Medium, sondern war ein Manuskript für einen Magazintext und später für ein Buch. Auch schön. Aber den Umweg über Twitter hätte sie nicht gebraucht. Immerhin haben jetzt die Feuilletons ein gutes Gefühl, weil sie auch einmal über einen „Twitterroman“ berichtet haben.
Wie Realität und Produktion und Autor-Ich und Rezeption in einem digitalen Schreibuniversum stattfinden können und es auch bereits tun, machte vor einigen Tagen der syrische Autor Aboud Saeed in einem Interview mit dem Zündfunk des Bayrischen Rundfunks deutlich. Saeed, der sich, ohne es zu wollen, mit seinen Facebook-Statusmeldungen einen Ruf als Autor erschrieben hat, als Autor, nicht als Facebook-Autor wohlgemerkt, treibt die Aufwertung von digitaler Realität als schöpferischem Ort weiter: „Facebook produziert die Realität. Warum bin ich hier, warum machst du das Interview mit mir, wie ist das Buch entstanden? Alles kam aus Facebook.“ So, wie der Fernbus online ist, sind auch Autorinnen und Autoren online. Sie werden davon – und damit und währenddessen – erzählen. Und wir müssen akzeptieren und lossurfen.