Der Wald. In seiner Weite, in seiner Unheimlichkeit wenn er dunkel und dicht ist. Ada und Theo fahren in eine Hütte, Ada ist schwanger und Theo versucht ein guter Partner zu sein, was Ada erst fuchsig macht, und dann traurig:
Deswegen nimmt Ada Theos Kopf in ihre Hände und versucht, Theo von ihrem Bauch weg hinunterzudrücken, dorthin, wo Ada lieber liebkost werden möchte. Aber sie ist zu grob und Theo fragt, was los ist, und Ada meint, dass sie nicht nur Bauch ist. Sie ist kein Brutkasten. Theo versteht gar nichts mehr und fragt noch mal, was jetzt los ist mit Ada auf einmal. Und Ada weiß es ja auch nicht, setzt sich aufs Sofa und fängt an zu weinen.
Jessica Lind entwirft hier das Psychogramm einer Paarbeziehung, die durch die Schwangerschaft auf die Probe gestellt wird. Die werdende Mutter steht im Vordergrund und mit ihr die Ängste und Zweifel am eigenen Anspruch zu scheitern.
Und dann ist da auf einmal ein Kind. Luise. Es ist da und kann reden, sagt andauernd „Mama“. Es wird nicht klar, zumindest nicht beim ersten Hören, ob das ein Traum ist, oder man einen Zeitsprung verpasst hat. Ob Ada sich das alles nur einbildet. „Es fühlt sich echt an“, denkt Ada einmal, und so geht es auch mir. Während Theo gleich der Superpapa ist, weiß Ada nicht wirklich damit umzugehen und probiert die Mutter-Rolle eher aus, als dass sie sich wirklich wohl darin fühlt.
Die Geschichte lebt von ihrer subtilen Art, unpathetisch, und der zart-zerbrechliche Ton der österreichischen Autorin unterstreicht das. Wenn am Ende nicht klar ist, ob Ada ihr Kind im Wald zurücklässt, wirkt das seltsamerweise gar nicht grausam. Unheimlich zwar, aber nicht grausam, weil in diesem Text keine Moral herrscht, sondern Leben.
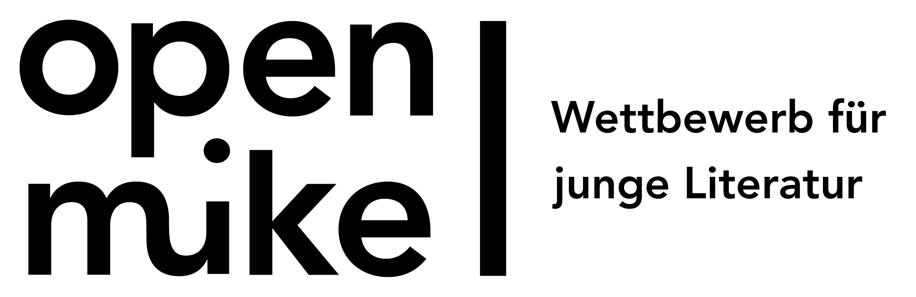
Ein Gedanke zu “Jessica Lind: „Mama“”